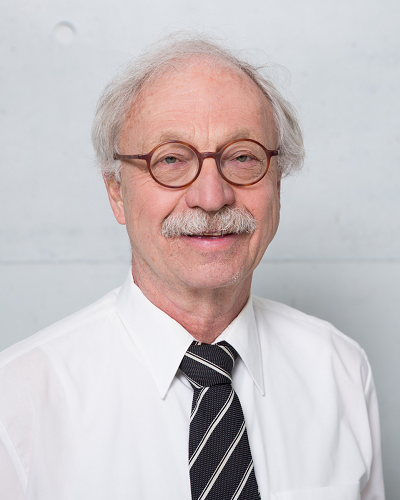In vielen Wohnungseigentümergemeinschaften bestehen an Teilen des gemeinschaftlichen Eigentums Sondernutzungsrechte. Nach der geltenden Rechtsauffassung ist ein Sondernutzungsrecht für die Grundsteuer ohne Bedeutung, sodass die Grundsteuer von allen Eigentümern zu tragen ist. Ob diese Rechtsauffassung richtig ist, dürfte zweifelhaft sein. Ein Ausgleichsanspruch gegenüber dem Berechtigten ist weder im BGB noch im WEG geregelt. M.E. ergibt sich ein solcher Anspruch jedoch aus Treu und Glauben (§ 242 BGB).
Wer zahlt die Grundsteuer für Sondernutzungsrechte?
In vielen Wohnungseigentümergemeinschaften bestehen an Teilen des gemeinschaftlichen Eigentums Sondernutzungsrechte. Durch das Sondernutzungsrecht wird ein bestimmter Teil der Grundstücksfläche Fläche oder des Gebäudes, die im Gemeinschaftseigentum stehen, einem der Sondereigentümer zur alleinigen Nutzung zugewiesen. Gesetzlich definiert ist der Begriff „Sondernutzungsrecht“ nicht, erwähnt ist es lediglich in § 5 Abs. 4 WEG. Hauptsächlich handelt es sich um Sondernutzungsrechte an Gartenflächen, Terrassen, Autoabstellplätzen und Garagen. Hintergrund ist, dass bis zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes zum 1. Dezember 2020 kein Sondereigentum an Flächen des Grundstücks begründet werden konnte.
Schuldner der Grundsteuer
Nach der geltenden Rechtslage zahlen sämtliche Mitglieder der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) die Grundsteuer anteilig auch für den Teil des Gemeinschaftseigentums, an dem ein Sondernutzungsrecht besteht. Nach bisheriger Auffassung ist das Sondernutzungsrecht im Rahmen der Grundsteuer unbeachtlich, weil Eigentümer des gemeinschaftlichen Eigentums trotz des Sondernutzungsrechts sämtliche Wohnungseigentümer als Miteigentümer sind. Die Sonderungsrechtsvereinbarung hat keine sachenrechtlichen Wirkungen. Das Ergebnis wird von vielen Eigentümer als ungerecht empfunden.
Schuldner der Grundsteuer ist nach § 10 GrStG derjenige, dem das Grundstück zuzurechnen ist. Dies ist gem. § 39 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) grundsätzlich der zivilrechtliche Eigentümer. Nur wenn das Grundstück einem anderen als wirtschaftlichem Eigentümer i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO zuzurechnen ist, ist dieser Schuldner der Grundsteuer. Dies ist beispielsweise bei einem Treuhänder der Fall. Der Inhaber des Sondernutzungsrechts gilt jedoch nicht als wirtschaftlicher Eigentümer, weil ihm nur die Nutzung zusteht, aber nicht die wirtschaftliche Substanz (BFH, Urt. v. 5.7.2018 – VI R 67/15).
Ausgleichsanspruch gegen den Sondernutzungsberechtigten
Einen Ausgleichsanspruch gegen den Begünstigten haben die Eigentümer in aller Regel nicht, da weder im WEG noch im BGB ein solcher Ausgleichsanspruch geregelt ist. Auch in der Teilungserklärung, durch die das betreffende Sondernutzungsrecht begründet ist, ist in aller Regel keine Bestimmung über einen Ausgleichsanspruch getroffen worden. Die nachträgliche Vereinbarung einer solchen Regelung ist ohne das Einverständnis des betroffenen Sondernutzungsberechtigten nicht möglich.
Vergleich mit dem Erbbaurecht und dem Nießbrauch
Vergleicht man die Situation mit der beim Nießbrauch und beim Erbbaurecht, so ergibt sich folgendes:
Durch § 261 BewG werden das Erbbaurecht und das belastete Grundstück zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst (§ 244 BewG) und diese dem Erbbauberechtigten zugerechnet. Schuldner der Grundsteuer ist deshalb der Erbbauberechtigte.
Der Nießbrauchsberechtigte ist grundsätzlich nicht wirtschaftlicher Eigentümer i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO. Denn er darf die Sache nur nutzen und ihre Früchte ziehen, während die Vermögenssubstanz ihm nicht zusteht. Das Grundstück ist daher trotz des Nießbrauchs dem zivilrechtlichen Eigentümer zuzurechnen, sodass dieser der Gemeinde gegenüber Schuldner der Grundsteuer ist.
Im Innenverhältnis ist der Nießbrauchsberechtigte dem Eigentümer jedoch gem. § 1047 BGB verpflichtet, die Grundsteuer zu tragen. Außerdem haftet er gem. § 11 GrStG der Gemeinde für die Grundsteuer, falls der Eigentümer diese nicht zahlt.
Lösung des Problems
Behandlung des Inhabers des Sondernutzungsrechts als wirtschaftlichen Eigentümer
Um zu einer gerechten Lösung u kommen, sollte man den Inhaber des Sondernutzungsrechts als wirtschaftlichen Eigentümer i. S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO ansehen. Hierfür spricht, dass der Berechtigte durchaus über die Vermögenssubstanz verfügen kann, weil er das Sondernutzungsrecht übertragen kann. Insofern unterscheidet sich das Sondernutzungsrecht von dem Nießbrauch, da es sich beim Nießbrauch um ein höchstpersönliches Recht handelt, das nicht übertragen werden kann. In der Grunderwerbsteuer wird das Sondernutzungsrecht dementsprechend gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 GrEStG wie ein Grundstück behandelt, wenn es dinglich gesichert ist. Zwar kann das Sondernutzungsrecht häufig nur zusammen mit der Eigentumswohnung verkauft werden. Durch einen Verkauf des Sondernutzungsrechts nimmt der Berechtigte jedoch an einer Wertveränderung wie ein Eigentümer teil. Auch wenn die Rechte, die sich aus dem Sondernutzungsrecht ergeben, eingeschränkt sind, weil der Berechtigte z.B. keine baulichen Veränderungen vornehmen darf, erscheint es daher gerechtfertigt, das Sondernutzungsrecht wie ein wirtschaftliches Eigentum zu behandeln. Denn auch der Inhaber eines Sondereigentums kann seine Wohnung nicht ohne weiters baulich verändern.
Handlungsmöglichkeiten
Um diese Rechtsauffassung durchzusetzen, müssen die Wohnungseigentümer gegen ihre Bescheide über den Grundsteuerwert Einspruch einlegen und geltend machen, dass das Grundstück den übrigen Miteigentümern nicht zuzurechnen ist, soweit ein Sondernutzungsrecht besteht. Wenn die Wohnungseigentümer ihren Einspruch mit Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit des neuen Grundsteuerrechts begründet haben, können Sie ihre Begründung erweitern und vortragen, soweit eine Sondernutzungsrecht besteht, sei das Grundstück nicht ihnen als zivilrechtlichem Eigentümer, sondern dem Berechtigten als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen.
Sollte der Bescheid bereits bestandskräftig sein, bleibt nur die Möglichkeit, eine fehlerbeseitigende Wertfortschreibung nach § 222 Abs. 3 BewG zu beantragen. Allerdings dürfte diese in der Regel daran scheitern, dass der Schwellenwert von 15.000 Euro nicht überschritten ist (§ 222 Abs. 1 BewG).
Ausgleichsanspruch gem. § 242 BGB
In den Fällen, in denen eine Änderung des Bescheides über den Grundsteuerwert nicht erreicht werden kann, haben die mit dem Sondernutzungsrecht belasteten Miteigentümer m.E. einen Ausgleichsanspruch gegen den Sondernutzungsberechtigten aus Treu und Glauben (§ 242 BGB). Aus der Regelung in § 1047 BGB über den Ausgleichsanspruch gegenüber dem Nießbrauchsberechtigten kann man m.E. entnehmen, dass ein solcher Anspruch der gesetzlichen Wertung entspricht.
Nach § 10 Abs. 1 GrStG ist derjenige Schuldner der Grundsteuer, dem der Steuergegenstand (§ 2 GrStG) bei der Feststellung des Grundsteuerwerts zugerechnet ist.
Die Zurechnung des Steuergegenstandes bei der Feststellung von Grundsteuerwerten i. S. d. § 219 Abs. 2 Nr. 2 BewG richtet sich nach der wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Wirtschaftsgüter sind gem. § 39 Abs. 1 AO grundsätzlich dem bürgerlich-rechtlichen Eigentümer zuzurechnen. Übt jedoch ein anderer als der bürgerlich-rechtliche Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den (bürgerlich-rechtlichen) Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut gem. § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO als sog. wirtschaftlicher Eigentümer zuzurechnen. Für Zwecke der Grundsteuer ist eine Zurechnungsfortschreibung auch dann vorzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum übergeht
Ansprechpartner
Bundesverband
Rechtsberater Referat Steuern
Der Beitrag Wer zahlt die Grundsteuer für Sondernutzungsrechte? erschien zuerst auf IVD.